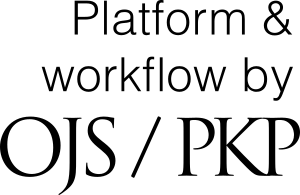(Über-)Leben nach dem Krieg
Helena in drei modernen Adaptionen
Abstract
Helena, die sogenannte Schönste aller Frauen, wird oft als der Auslöser des Trojanischen Kriegs angegeben, sie fungiert als (Lust-)Objekt und Sündenbock. Sie wird auf ihr Äußeres und das Verlassen ihrer Heimat reduziert und darüber definiert. Doch wie ergeht es ihr nach dem Krieg? Wie stehen die Personen beider Kriegsparteien zu ihr? Wie wird Helena rezipiert und nach dem Trojanischen Krieg von ihrem sozialen Umfeld gesehen? Anhand der Romane Eine ganz gewöhnliche Ehe. Odysseus und Penelope (1989) und The Women of Troy (2021) werden die Meinungen der griechischen sowie trojanischen Frauen und Männer aufgezeigt und die Aspekte Schuld, victim blaming, Solidarität unter Frauen, Sexualität und Schönheit betrachtet. Während hier aus heutiger Perspektive wenig feministisches Gedankengut zum Vorschein kommt, sondern Helena zumeist das Objekt der Begierde oder das Ziel von Racheschwüren bleibt, lässt sich in der DC-Serie Legends of Tomorrow (2017) ein anderer, emanzipatorischer Ansatz finden: Das moderne Superheld*innenteam erkennt – vermutlich auch über den bestehenden zeitlichen und emotionalen Abstand zum Trojanischen Krieg – Helena ihre Selbstbestimmung nicht ab, sondern ermöglicht ihr ein alternatives Ende, in dem sie den Krieg und auch die Männer hinter sich lassen kann.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Milena Esther Hofmeister

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 3.0 International.
Autorinnen und Autoren, die in eisodos einen Beitrag veröffentlichen, bleiben in Besitz des Copyrights, garantieren aber eisodos das Recht auf Erstpublikation. Mit der Publikation wird der Artikel einer Creative Commons Attribution License (CC BY) unterstellt, die es erlaubt, den Artikel unter vollständiger Nennung der bibliographischen Angaben (Nennung von Autorname und Erstpublikation in eisodos) mit anderen zu teilen.
Es steht den Autorinnen und Autoren frei, ihren Beitrag außerdem in anderen Medien (bspw. auf der universitären Homepage oder als Kapitel in einem Buch) in nicht-exklusiver Weise und unter Nennung der Erstpublikation in eisodos zu veröffentlichen.
Autorinnen und Autoren werden ausdrücklich dazu ermuntert, ihren Beitrag vor und während der Veröffentlichung in eisodos online zu diskutieren (bspw. auf ihrer eigenen oder der universitären Homepage). Dies führt zu produktivem Austausch und zu früherer Kenntnisname und Verwendung des im Anschluss daran in eisodos veröffentlichten Beitrags sowie der Verweisung auf ihn.