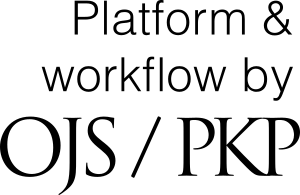Die ideale Frau als Skulptur in Ovids "Pygmalion"-Episode und Henrik Ibsens "Wenn Wir Toten Erwachen"
Abstract
Die Künstlerfiguren Pygmalion aus Ovids Metamorphosen und Arnold Rubek aus Henrik Ibsens Wenn wir Toten erwachen (1899) eröffnen mit der Gestaltung einer idealen Frau in Skulpturform das Spannungsfeld zwischen der männlichen Erwartung bezüglich weiblichen Verhaltens und den Wunschvorstellungen auf Seiten der Frau. Wollte Ibsen die Idealisierung der Frau aus feministischer Sicht kritisieren? Und inwieweit lässt sich Pygmalion wirklich als romantischer Liebhaber lesen? Der unberührte weibliche Körper, das Bild einer reinen Frau, bedeutet für Rubek die Erleuchtung und begründet gleichzeitig das Ende seiner künstlerischen Motivation. Mit der Anerkennung von weiblichen Idealen als fehlbar stirbt seine Illusion von der Auferstehung in Form einer Jungfrau. Für Pygmalion bedeutet die Statue die Erfüllung sexueller und platonischer Liebe; keine reale Frau kann diese Erwartungen erbringen. Die Frauenstatuen als Kunstwerke offenbaren den Anspruch des patriarchalen Künstlertums an Weiblichkeit. Rubeks Utopie führt zu Liebesmissbrauch und „Tod“ im metaphorischen und tatsächlichen Sinn. Pygmalion hingegen bleibt verblendet und wird mit der Lebendigkeit seines Werkes belohnt, was aus feministischer Sicht und in Hinblick auf die Frau als Individuum jedoch problematisch bleibt.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Franziska Leonie Fritsch

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 3.0 International.
Autorinnen und Autoren, die in eisodos einen Beitrag veröffentlichen, bleiben in Besitz des Copyrights, garantieren aber eisodos das Recht auf Erstpublikation. Mit der Publikation wird der Artikel einer Creative Commons Attribution License (CC BY) unterstellt, die es erlaubt, den Artikel unter vollständiger Nennung der bibliographischen Angaben (Nennung von Autorname und Erstpublikation in eisodos) mit anderen zu teilen.
Es steht den Autorinnen und Autoren frei, ihren Beitrag außerdem in anderen Medien (bspw. auf der universitären Homepage oder als Kapitel in einem Buch) in nicht-exklusiver Weise und unter Nennung der Erstpublikation in eisodos zu veröffentlichen.
Autorinnen und Autoren werden ausdrücklich dazu ermuntert, ihren Beitrag vor und während der Veröffentlichung in eisodos online zu diskutieren (bspw. auf ihrer eigenen oder der universitären Homepage). Dies führt zu produktivem Austausch und zu früherer Kenntnisname und Verwendung des im Anschluss daran in eisodos veröffentlichten Beitrags sowie der Verweisung auf ihn.