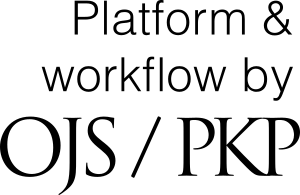This Sphinx Which Is Not One
Die Macht der Nicht-Binarität und des Intersex in der ägyptischen und griechischen Darstellung des/der Sphinx
Abstract
Ödipus ist auf der Reise von Korinth nach Theben, als er der Sphinx begegnet, die die Stadt Theben belästigt und umbringt, wer ihr Rätsel nicht lösen kann. Einzig Ödipus ist dazu in der Lage. Die Sphinx, besiegt, begeht Suizid. Als Lohn für diese Befreiung wird Ödipus zu Thebens König gekrönt und erhält die verwitwete Königin Jokaste, seine Mutter, zur Frau. Als geflügeltes Wesen mit menschlichem Kopf (und Oberweite) und Löwenkörper prägt die Sphinxfigur die Vorstellungen von Wissen und gefährlicher Macht. Im Alten Ägypten als männliches Fabelwesen, im antiken Griechenland als weibliche Figur dargestellt, zieren multiple Darstellungen und Skulpturen wie jene in Gizeh oder die Gemälde des französischen Künstlers Ingres, ebenso wie narrative Vorstellungswelten, die bis heute verbreitet sind.
Dieser Artikel soll die nicht-Binarität der mythologischen Figur aufzeigen und den/die Sphinx als transzendentales Wesen anhand einer Diskussion über Geschlechterbilder unter den drei hierarchischen Machtkonstrukten des Männlichen, der Sprache und des Wissens aufzeigen. Dies soll anhand der Überlieferungen von Apollodor, Euripides und Sophokles erfolgen, sowie moderner, linguistischer und deutungspolitischer Ansätze von Muriel Rukeyser und Julia Kristeva.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Johanna Böttiger

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 3.0 International.
Autorinnen und Autoren, die in eisodos einen Beitrag veröffentlichen, bleiben in Besitz des Copyrights, garantieren aber eisodos das Recht auf Erstpublikation. Mit der Publikation wird der Artikel einer Creative Commons Attribution License (CC BY) unterstellt, die es erlaubt, den Artikel unter vollständiger Nennung der bibliographischen Angaben (Nennung von Autorname und Erstpublikation in eisodos) mit anderen zu teilen.
Es steht den Autorinnen und Autoren frei, ihren Beitrag außerdem in anderen Medien (bspw. auf der universitären Homepage oder als Kapitel in einem Buch) in nicht-exklusiver Weise und unter Nennung der Erstpublikation in eisodos zu veröffentlichen.
Autorinnen und Autoren werden ausdrücklich dazu ermuntert, ihren Beitrag vor und während der Veröffentlichung in eisodos online zu diskutieren (bspw. auf ihrer eigenen oder der universitären Homepage). Dies führt zu produktivem Austausch und zu früherer Kenntnisname und Verwendung des im Anschluss daran in eisodos veröffentlichten Beitrags sowie der Verweisung auf ihn.